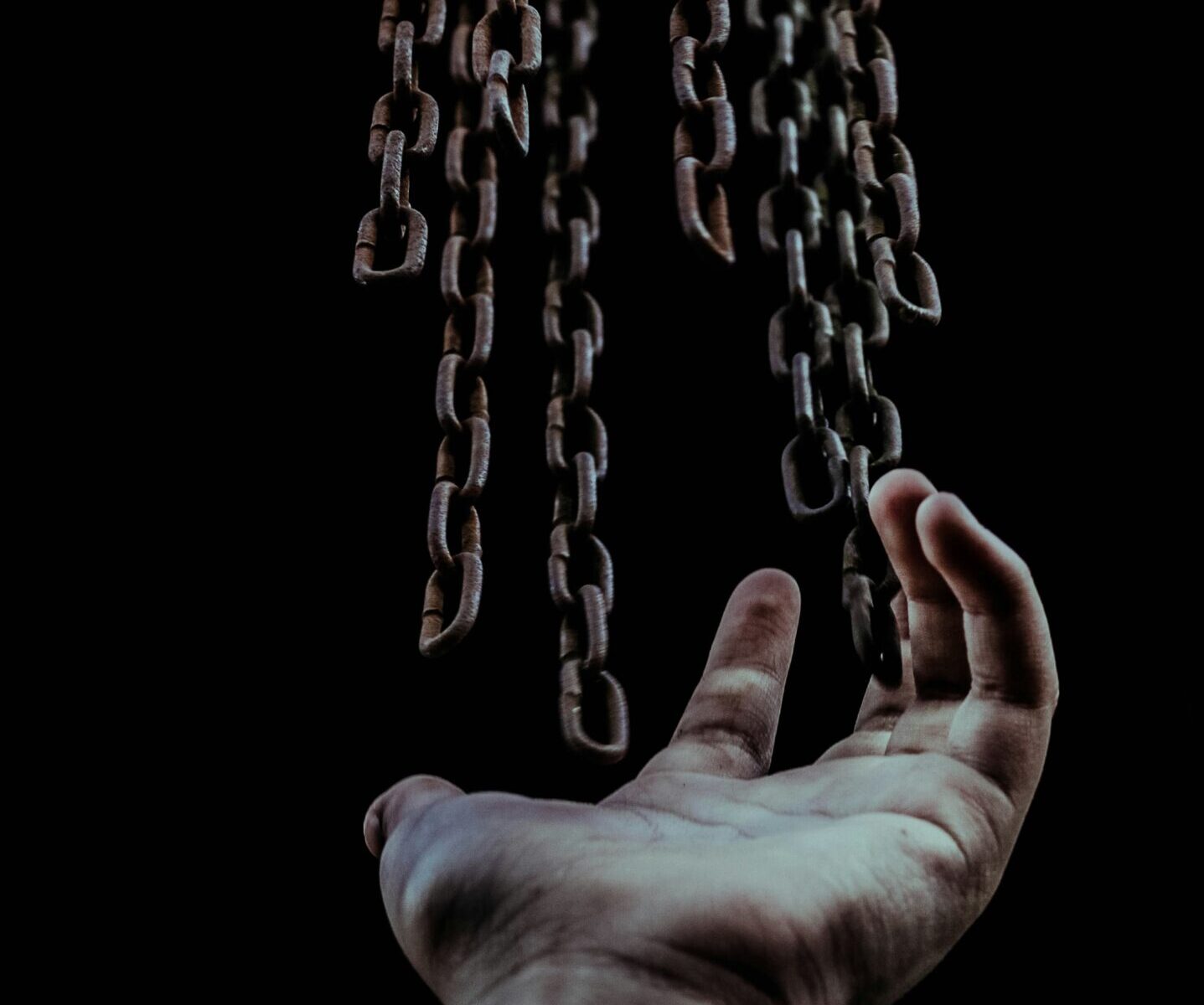Die konkreten Aufforderungen zur Gewalt bis hin zum Aufruf zum Völkermord in der Bibel sind eine der grössten Anfragen an den christlichen Glauben. Wie sollen solche Texte zu einem liebenden Gott passen?
Sicher: Es ist eine Tatsache, dass der Mensch zur Gewalt gegenüber anderen neigt. Die Bibel ist hier erschreckend realistisch. Das eigentliche Problem ist ein anderes: Gott selbst fordert an manchen Stellen direkt zur Gewalt auf. Ein drastisches Beispiel findet sich ein Kapitel später in 1. Samuel 15,3. Dort lesen wir:
„So zieh nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was sie haben. Schone ihrer nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel.“
Hier ruft Gott selbst zum Genozid auf – zur Tötung von unschuldigen Tieren und hilflosen Kindern und Säuglingen. Das lässt sich nicht einfach überlesen oder spirituell schönreden.
Für mich zeigt sich hier eines der grössten Missbrauchspotenziale von Religion: Gott wird für die eigene Partei oder Position beansprucht. Mit Gott an seiner Seite wird daraus das Recht abgeleitet, anderen Gewalt anzutun. Physisch. Aber auch argumentativ oder psychisch.
Diese Logik ist erschreckend aktuell: Gott ist mit mir – darum gehört dieses Land nun mir.
So wurde und wird Krieg religiös legitimiert. So werden Menschen entrechtet, weil sie „nicht zu Gottes Volk“ gehören. So werden Minderheiten im Namen Gottes ausgegrenzt. Und so wird bis heute spirituelle Autorität missbraucht: Wenn jemand behauptet, Gottes Stimme gehört zu haben, und diese vermeintliche Offenbarung benutzt, um andere zu kontrollieren, einzuschüchtern oder zu manipulieren.
Gerade deshalb müssen wir fragen: Wie sollen – wie können – wir mit solchen Texten umgehen?
Dies vorweg: Eine abschliessende Antwort habe ich nicht. Ich ringe um dieses Thema. Aktuell gibt es fünf Gedanken bzw. Ansätze, die ich bedenkenswert finde, die ich mit euch teilen möchte und die einladen, weiterzudenken.
1. Es geht nicht, das Problem ins „Alte“ Testament abzuschieben
Die Texte können nicht als „alttestamentlich“ abgetan werden. Dies ist eine weit verbreitete Lösung: die Gewalt als ein alttestamentliches Problem darzustellen. Im Neuen Testament, insbesondere durch die Lehre Jesu und seine Betonung der Liebe, sei dieses überwunden: „Früher wusste man es halt nicht besser, aber Jesus hat uns das wahre Wesen Gottes als liebenden Vater gezeigt.“
Diese Argumentation führt dazu, zwischen dem Gott im Ersten Testament und im Zweiten Testament zu unterscheiden. Doch so einfach ist es nicht. Die christliche Tradition hat immer wieder betont, dass der Gott des Neuen Testaments ein und derselbe ist wie im Ersten.
Dazu kommt, dass auch das Neue Testament harte und verstörende Texte kennt – man denke nur an Gerichtsbilder oder die Offenbarung. Und die Kirchengeschichte macht schmerzhaft deutlich: Auch Christen haben Gewalt religiös legitimiert, Kreuzzüge geführt, Kolonialismus betrieben und Menschen im Namen Gottes unterdrückt.
2. Alles hängt an unserem Bibelverständnis
Entscheidend ist, wie wir die Bibel lesen und verstehen. Das ist ein umfassendes Thema, das ich hier nur kurz anreissen kann.
Wichtig ist: Die Bibel erhebt nicht den Anspruch, eins zu eins Gottes Willen wiederzugeben. Sie ist keine Sammlung zeitloser, wörtlicher Aussagen oder gar Anweisungen Gottes, die sich direkt auf heute übertragen liessen. Sie ist auch kein Diktat Gottes – wie dies der Koran beansprucht – bei dem jedes Wort unmittelbare göttliche Selbstoffenbarung wäre.
Die Bibel ist eine komplexe Sammlung unterschiedlichster Texte, verfasst und redigiert über die Jahrhunderte hinweg von etlichen Autoren, die verschiedenste Stilmittel und Textgattungen verwendeten und immer eingebettet in ihre Zeit und Kultur schrieben. So plural ist der Kontext der biblischen Erfahrungsberichte: Menschen erzählen auf ihre Art, wie sie Gott in ihrer Kultur und Zeit erlebt haben – und deuten diese Erfahrungen theologisch. Dabei werden nicht nur positive Beispiele erzählt. Oft berichtet die Bibel schonungslos ehrlich von falschem Umgang mit Gott und unrechter Deutung seines Wesens und seines Willens.
Gerade deshalb ist der Kontext so wichtig. Einzelne Verse oder Erzählungen lassen sich nicht isoliert verstehen. Sie müssen immer im grösseren Zusammenhang gelesen werden – literarisch, historisch und innerhalb der gesamten biblischen Erzählung. Dies trifft auch auf die gewaltvollen Stellen der Bibel zu.
3. Viele Gewalttexte entstehen aus Trauma und Ohnmacht
Betrachten wir den Kontext vieler gewaltsamer Texte, so fällt auf, dass diese nicht aus einer Position der Übermacht, sondern meist aus Verletzung und Schwäche heraus entstanden sind. Die Philister waren militärisch überlegen. Später kamen die Grossmächte der Assyrer und der Babylonier. Jerusalem wurde zerstört, der Tempel niedergebrannt, grosse Teile der Bevölkerung verschleppt.
Insbesondere in der babylonischen Gefangenschaft, in der Erfahrung von Ohnmacht und Leid, erinnerten sich die Israeliten an die vergangenen Heldentaten von Mose, Samuel und David. Viele der alten Geschichten fanden hier zu neuer Wichtigkeit, wurden verschriftlicht, redigiert und im Schatten der erlebten Katastrophen neu gedeutet.
Sicher, das ist bibelwissenschaftlich stark verkürzt und vereinfacht dargestellt. Doch es macht einen Unterschied, ob Gewaltgeschichten von Siegern erzählt werden – oder von Menschen, die Verlust, Vertreibung und Ohnmacht erlebt haben.
Die drastischen Texte können so als Ausdruck von Schmerz, von der verzweifelten Suche nach Sinn im Angesicht von Leid verstanden werden: Wo war Gott? Warum ist das passiert? Wie können wir trotzdem weiterleben und glauben?
Trauma spricht oft in absoluten Bildern. Angesichts von unfassbarem Leid und Ungerechtigkeit ist es nachvollziehbar, dass man den Feinden, die einem dies angetan haben, im Namen Gottes nur das Schlimmste wünscht. Auch das gehört zur Ehrlichkeit der Bibel.
4. Auffällig ist: Die Gewalt wird Gott überlassen – Gott ist dabei weder parteiisch, noch bejaht er durchgehend die Gewalt. Dies zeigt sich am Ende in Jesus Christus.
So verstörend viele Texte sind: Etwas fasziniert mich zugleich.
Die Bibel legt die Gewalt bewusst in Gottes Hände. Israel nimmt die Rache nicht einfach selbst in Anspruch. Jonathan überlässt es etwa in 1. Samuel 14 Gott selbst, ob er ihm im Kampf gegen die Philister beisteht. Und in den blutrünstigen Psalmen, wie etwa Psalm 137, richtet sich der Verfasser mit seinen rachsüchtigen Vergeltungsfantasien direkt an Gott und überlässt ihm dadurch letztlich die Vergeltung und Gewalt.
Dadurch zeigt die Bibel, dass erfahrene Gewalt kein Freibrief für menschliche Vergeltung ist. Gott wird die Verantwortung als Richter zugesprochen. Das Gottesbild ist für uns heute oft schwer auszuhalten, doch darin wird etwas Entscheidendes im Umgang mit Gewalt deutlich: Der Mensch soll die Rache nicht selbst in die Hand nehmen. Biblisch gesehen liegt die Autorität für Gewalt und Vergeltung in Gottes Hand.
Dabei fällt auf: Gott stellt sich in der Bibel erstaunlich oft nicht auf Israels Seite. Immer wieder verlässt Gott sein eigenes Volk. Er lässt Niederlagen zu. Er kritisiert militärischen Hochmut und Machtmissbrauch. Die Propheten warnen davor, Sicherheit in Waffen zu suchen.
Parallel dazu zieht sich eine starke Kritiklinie gegenüber Gewalt und Krieg durch das Erste Testament: ein grundsätzliches Aufbegehren gegen Krieg, Gewalt und Rache. Visionen, in denen Schwerter zu Pflugscharen werden. Träume von globalem Frieden. Segenszuspruch nicht nur für Israel, sondern für alle Völker – sogar für die Feinde.
Diese Linie ist entscheidend. Sie bildet die Grundlage für das Handeln und die Lehre Jesu. Jesus stellt somit keinen Bruch mit dem Ersten Testament dar. Im Gegenteil: In ihm findet diese Deutung ihre konsequente Fortführung und ihren Höhepunkt. Gerade im Angesicht der römischen Besatzungsmacht verweigert er sich der Logik von Vergeltung. Er geht nicht den Weg der Gewalt. Stattdessen durchbricht er den Kreislauf von Hass und Rache durch seine Hingabe, durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung.
5. Eine allegorische Spur: Diese Texte erzählen auch von unseren eigenen Kämpfen
Angesichts dieser Überlegungen dürfen und sollen wir uns mit allen Texten der Bibel – auch den unklaren, schwierigen und gewaltvollen – auseinandersetzen und darin Schätze und Weisheiten für unseren Alltag finden.
Ein Weg – der letztlich in den meisten Predigten gewählt wird – ist, über den historischen und literarischen Kontext hinaus die Texte allegorisch zu deuten. Wir dürfen die Berichte über Kämpfe und Auseinandersetzungen auch symbolisch verstehen und daraus Prinzipien für unsere alltäglichen Herausforderungen und Konflikte ableiten. Nicht jede Schlacht muss äusserlich gedeutet werden. Vieles lässt sich auf innere Prozesse beziehen: Angst, Mut, Versuchung, Vertrauen.
In dieser Perspektive können selbst schwierige Geschichten geistlich fruchtbar werden.
Ein schönes Beispiel ist etwa 1. Samuel 14: Jonathan und sein Waffenträger wagen einen mutigen Schritt, obwohl die Lage aussichtslos scheint. Daraus lässt sich Entscheidendes über echten Mut, Vertrauen und die entscheidende Kraft des zweiten Mannes ableiten.
Das ist jedoch Stoff für einen anderen Blog – hier kannst du nachlesen was wir aus 1. Samuel 14 über echten Mut lernen können.
Dieser Text entstand in Zusammenarbeit mit KI-gestützten Werkzeugen. Der Autor hat Inhalte, Struktur und Formulierungen eigenständig konzipiert und redaktionell bearbeitet.