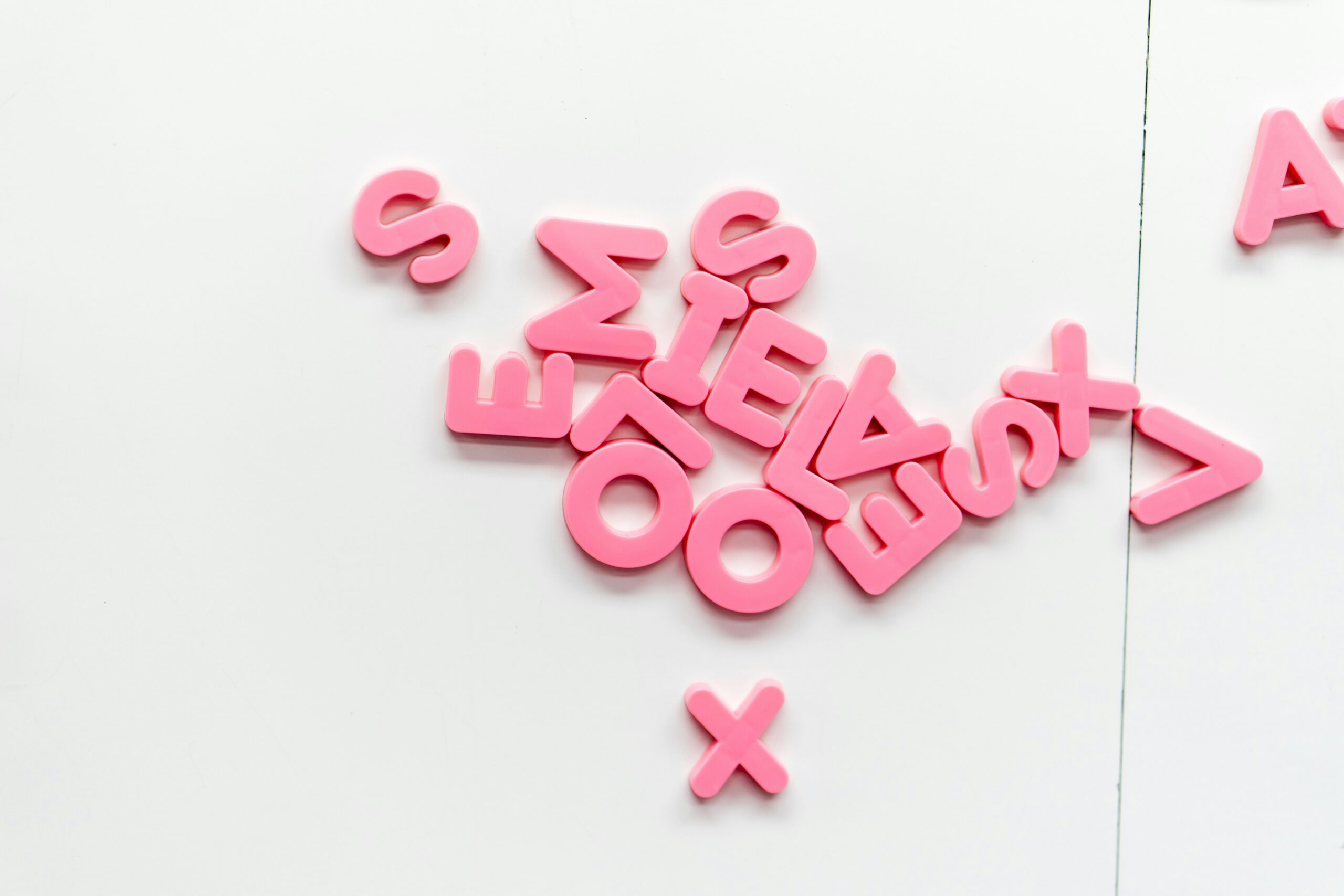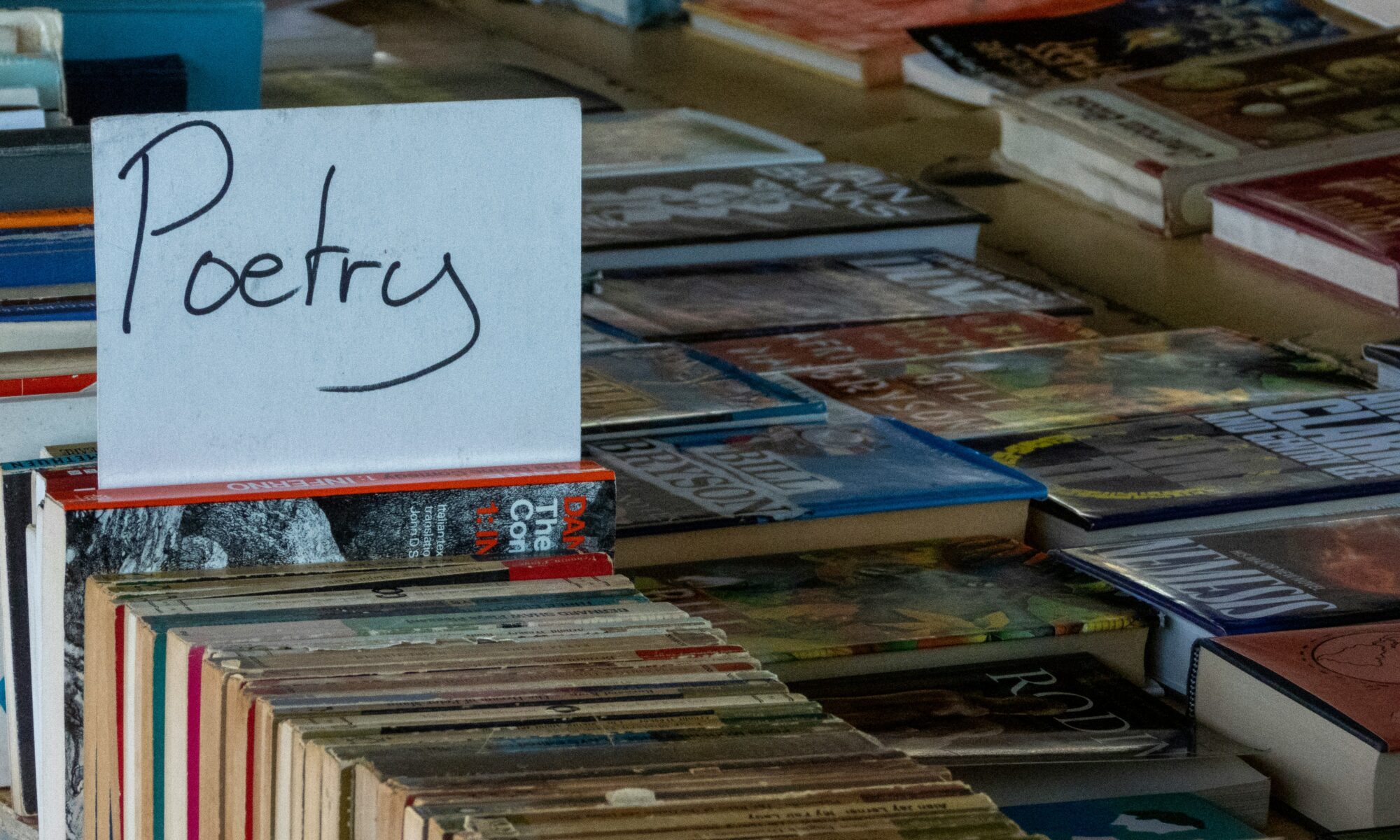Hugo Stamm hat es wieder einmal getan. Er hat erneut zu einem Rundumschlag gegen etliche religiösen Exponenten der Schweiz ausgeholt. Und wieder kommt er zu seiner altbekannten Schlussfolgerung: Religion schadet, und ihre Verkündiger verursachen nur Leid und Verwirrung.[1] Diese immer gleiche Leier mag ihren Unterhaltungswert haben – doch nun, da sie auf die Tragödie und das Leid von Crans-Montana angewendet wird, ist sie schlicht fehl am Platz.
Scheitern die kritisierten Erklärungsansätze? Ja, grösstenteils. Verfehlen sie es allen Familien, insbesondere religiös Distanzierten, Trost zu spenden? Höchstwahrscheindlich. Doch was ist die Alternative? Auf Stamms Kritik folgt auch dieses Mal kein eigener Lösungsansatz. Kritisieren ist das eine, selbst tätig zu werden das andere. Um Worte zu ringen in einer unaussprechlichen Situation – das ist schwierig und mutig. Und hier gäbe es für Herrn Stamm viel Arbeit zu tun.
Wer Religion kritisiert, soll bitte auch eigene und neue Antworten liefern. Wie kann ohne Glauben mit einer solchen Tragödie umgegangen werden? Wie können die Schuldigen, die in den nächsten Tagen gnadenlos mit den Folgen ihres Fehlverhaltens konfrontiert werden, Vergebung finden? Und auch über das aktuelle Leid hinaus sind Verfechter einer säkularen Gesellschaft mit grossen Fragen konfrontiert, auf die ich selten bis nie Antworten höre – geschweige denn ein Bewusstsein für diese Fragen.
Fragen wie: Mit welchem Narrativ, wenn nicht mit dem christlichen, entwickeln Gesellschaften ein gesundes Wir-Gefühl, ohne dabei ausgrenzend zu werden? Wie lässt sich Menschenwürde als Grundlage der Menschenrechte begründen? Was schenkt dem Menschen Sinn? Und falls es gar keinen Sinn braucht – wie sieht dann ein gutes Leben ohne Sinn aus? Wie lassen sich Moral und Ethik ohne Gott begründen und einfordern?
Auf diese und viele weitere Fragen könnten Kritiker wie Herr Stamm sich um Antworten bemühen. Doch dazu fehlt wohl der Mut. Denn wer dies wagt, wird scheitern – und macht sich angreifbar.
Ich für meinen Teil will nicht bei der Kritik stehen bleiben. Ich reihe mich gern in die Reihe der Menschen ein, die um Worte ringen und mit ihren Antworten scheitern. Denn einfache und richtige Worte gibt es im Angesicht solchen Leides nicht. In vielem gibt es keine Antwort. Meist bleibt nur das Schweigen. Und doch – trotz des Wissens, dass es keine Worte gibt, die dieser Situation gerecht werden – möchte ich es wagen, ein paar Gedanken zu formulieren. Es ist ein Versuch. Ein Ringen um Worte, die in aller Schwäche das Schweigen und damit auch die Einsamkeit zu überwinden versuchen. Denn wenn alles Reden scheitern muss, so schafft es zumindest Nähe.
Dabei schenkt ein Blog nie die Nähe, die Opfer und Angehörige jetzt dringend brauchen. Das ist hier nicht meine Aufgabe und nicht mein Ziel. Ich bin dankbar für die unzähligen Menschen, die in den letzten Tagen den Betroffenen nahegestanden sind und sie in diesem unfassbaren Leid begleiten.
Die nachfolgenden Überlegungen werden der Situation nicht gerecht. Die skizzierten Antworten versuchen das Leid nicht „wegzuerklären“. Sie sind ein Ringen darum, dem Geheimnis näherzukommen, wie wir mit Leid in dieser Welt umgehen können. Vielleicht finden wir darin auch Wege, unserem eigenen Leid zu begegnen – und darüber hinaus andere in ihrem Leid zu begleiten.
Die Frage der Theodizee
Die Frage nach dem Leid und nach Gottes Gerechtigkeit – die sogenannte Theodizeefrage – begleitet die Menschheit seit ihren Anfängen. In der Bibel, in unserer Tradition, aber auch in persönlichen Gesprächen stossen wir auf viele Versuche, dem Rätsel des Leidens beizukommen. Doch selten finden wir eine allumfassende Antwort.
Nachfolgend stelle ich drei mögliche Kategorien von Antworten vor, mit jeweiligen Spielarten. Ich verdanke diese Überlegungen der Theologieprofessorin Veronika Hoffmann, die sie mir in ihrer Dogmatik-Vorlesung zur Theodizee nähergebracht hat. Jede Antwort kann einen Beitrag leisten – zugleich scheitert jede und kann im falschen Kontext mehr Schmerz als Trost verursachen.
1. „Leid hat einen Sinn / eine Funktion“
Ein Ansatz ist, dem Leid in dieser Welt einen Sinn zuzuschreiben. Leid kann so verstanden werden, dass es eine Funktion in unserem Leben hat – ja, dass Gott sich des Leids bedient, um ein grösseres Ziel zu verwirklichen.
a) Unser Handeln hat Konsequenzen (Tun-Ergehen-Zusammenhang)
Die Bibel lehrt uns an vielen Stellen, dass unser Tun Folgen hat. Im Buch der Sprüche lesen wir:
„Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein; wer einen Stein hochwälzt, auf den rollt er zurück.“ (Sprüche 26,27)
So wie es Naturgesetze gibt, existieren auch Beziehungsgesetze: Wenn wir lügen, betrügen oder andere verletzen, wirkt sich das früher oder später auf uns selbst aus. Dieser Zusammenhang erklärt manches Leid, das wir durch eigenes Fehlverhalten auslösen.
Auch die Katastrophe von Crans-Montana hat menschliche Ursachen. Barbetreiber und Behörden haben Fehler gemacht, die diese Tragödie mitverschuldet haben.
Gleichzeitig stellt die Bibel diesen Zusammenhang infrage. Das Buch Hiob zeigt uns einen Gerechten, der leidet, obwohl er kein Unrecht getan hat. Jugendlichen die Schuld für ihr Sterben in der Silvesternacht zu unterstellen, zeigt die drastische Grenze dieser Erklärung.
Zugleich: Im Neuen Testament übersteigt Jesu Gnade das Prinzip „Wie du mir, so ich dir“. Gott sprengt in Jesus Christus die engen Grenzen von Ursache und Wirkung und schafft so die Grundlage zur Vergebung. Gnade durchbricht Karma. Diese Gnade und Vergebung wird für die Schuldigen dieser Katastrophe zentral sein, wenn sie den Weg zurück ins Leben finden wollen.
b) Leid als Strafe Gottes
Eine andere Deutung ist die Vorstellung, Leid sei Gottes Strafe für unsere Sünden. Im Buch Josua heisst es:
„Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, dann wird er sich von euch abwenden, wird Unglück über euch bringen…“ (Josua 24,20)
Religionsgeschichtlich ist diese Sichtweise bedeutsam. Das Volk Israel suchte – anders als viele andere antike Kulturen – die Ursache von Katastrophen nicht bei fremden Göttern oder dämonischen Mächten, sondern bei sich selbst. Sie hielten an ihrem Gott fest, auch in Niederlagen und im Exil. Unglück wurde als Anlass zur Selbstprüfung verstanden, nicht als Beweis für die Schwäche Gottes. Diese Sicht nimmt die Israeliten in eine Selbstverantwortung und spricht ihnen die Möglichkeit zu, ihre Situation selbstbestimmt zu verändern. Sie sind nicht das Opfer ihrer Unterdrücker, sondern können mit Gottes Hilfe ihre leidvolle Situation verändern.
Ist es sinnvoll, durch die Katastrophe das überhebliche Selbstverständnis der Schweiz, alles im Griff zu haben und mit Organisation vermeintliche Sicherheit zu schaffen, zu hinterfragen? Vielleicht.
Doch darf das Leid der Jugendlichen als Strafe Gottes gedeutet werden? Auf keinen Fall.
Hier wird diese Erklärung destruktiv und unmenschlich. Den Hinterbliebenen würde zusätzlich unerträgliche Schuld aufgebürdet. Das Gottesbild des zornigen Strafenden ist seelsorgerlich schädlich und missbräuchlich.
c) Leid als Erziehung
Der Psalmist bekennt: „Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Ordnungen lernte.“ (Psalm 119,71)
In manchen Biografien führte erfahrenes Leid zu einer Kehrtwende, die viel Positives ermöglichte. Manche sehen darin einen „Weckruf“. Manche Christinnen und Christen erleben, dass sie in Krisen eine neue Tiefe im Glauben finden. Aus Leid zu lernen, ist weise. Sich aus gegebenem Anlass bewusst auf den neuesten Stand beim Verhalten von Bränden zu bringen, ist sicher eine wichtige Lektion.
Leid pädagogisch zu begründen ist jedoch fehl am Platz. Direktbetroffenen zu sagen, die erfahrene Situation sei eine Chance etwas Wichtiges zu lernen, ist lieblos und verletzend. Die Erkenntnis, aus dem erfahrenen Leid positive Schlüsse zu ziehen, kann nur jede und jeder zu seiner Zeit für sich selbst entdecken. Und wenn das Leid so gross ist wie der Verlust eines eigenen Kindes, ist es menschlich gesehen unmöglich, darin eine lebensfördernde Lektion zu erfahren.
2. „Leid ist nicht vermeidbar“
Die zweite Kategorie von Antworten entspringt philosophischen Überlegungen. Eine Welt, die dem Menschen die Freiheit des eigenen Willens zuspricht, ist nur so konzipierbar, dass Leid in ihr möglich sei
a) Leid als Folge des freien Willens
Menschen fügen einander und sich selbst Leid zu. Um den freien Willen zu achten, verhindert dies Gott nicht. Ohne die Freiheit zur Liebe gäbe es auch nicht die Freiheit zum Bösen – wir wären nur Marionetten. In dieser Sicht ist Leid als Verschuldung der Menschen selbst zu verstehen. Leid entsteht, weil wir unsere Freiheit missbrauchen.
Doch was ist, wenn jemand unschuldig Leid erfährt aufgrund des Fehlverhaltens anderer?
Was ist mit systemischem Unrecht, mit Strukturen, die Leid hervorbringen? Wie lassen sich so Naturkatastrophen erklären, die niemand direkt „verschuldet“ hat? Die Rede vom freien Willen erklärt dieses systemische Leid nicht.
b) Leid durch Naturgesetze
Ein weiterer Gedanke ist, dass Gott eine Welt geschaffen hat, in der verlässliche Naturgesetze herrschen. Diese Verlässlichkeit, wie die der Gravitation, ist nötig für Leben und Freiheit. Wie soll ich mein Leben gestalten, wenn ein Stein mal zu Boden fällt und ein anderes Mal einfach in der Luft hängen bleibt?
Zugleich führen die Naturgesetze zwangsläufig auch zu Erdbeben, Stürmen oder Krankheiten. So gesehen ist das Leid die Folge der verlässlichen Naturgesetze. Manche Theologen argumentieren daher, diese Welt sei „die bestmögliche aller Welten“. Leid wird so als notwendige Kehrseite einer verlässlichen und dadurch freien Welt verstanden.
Doch gerade persönliches und seelisches Leid lässt sich so nicht erklären. Zudem ist diese Sicht im seelsorgerlichen Einzelfall kalt und herzlos. Der verstorbene Partner oder auch die Hunderte von Menschen, die durch eine Naturkatastrophe sterben, werden als Opportunitätskosten für eine verlässliche Welt und die menschliche Freiheit hingenommen.
3. „Es gibt keine Antwort auf das Warum“
Eine dritte Kategorie von Antworten entzieht sich der Frage nach dem Warum von Leid. Diese Antworten versuchen, einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen. Weg vom begründenden Warum hin zum ermöglichenden Wozu.
a) Gott leidet mit uns – Gott ist da in unserem Leid
Besonders tröstlich ist für mich die Botschaft, dass Gott mit uns mitleidet. Am Kreuz ruft Jesus: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Matthäus 27,46)
In Jesus wird Gott selbst zum Leidenden, er kennt Verlassenheit, Schmerz und Tod. Das kann uns in unserem Leid auf eine tiefe Weise berühren: In Jesus Christus kennt Gott den Schmerz dieser Welt. Im Leiden ist er uns nahe und spricht uns zu: „Ich weiss, wie es dir geht. Ich leide mit dir.“
Doch manche fragen: „Was hilft es mir, wenn Gott mitleidet, aber mein Leid nicht beendet?“ Mitleiden bietet vielleicht keinen Ausweg aus dem Leid, doch die Erfahrung zeigt: Trost beginnt oft damit, dass uns jemand versteht und mit uns fühlt – und Gott versteht uns wie niemand sonst. Dieser Zuspruch, dass Gott uns im Leid nahe ist und mitleidet, ist für mich zutiefst tröstlich. Christus als der mitleidende Gott ist für mich einer der grössten Schätze des christlichen Glaubens.
b) Leid ist zu bekämpfen – unser Auftrag, Leid zu lindern
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Aufruf, das Leid nicht hinzunehmen, sondern es zu bekämpfen. Eine biblische Vision sagt:
„Wolf und Lamm sollen beieinander weiden; der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind … Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der HERR.“ (Jesaja 65,25)
Unsere Welt entspricht nicht diesem Bild. So ist die Theodizeefrage eine „Rückfrage“ an Gott: „Warum lässt du das zu? Gott, die Welt ist nicht so, wie du sie versprochen hast!“ – So kann uns das Leid ins Gebet führen, wo wir mit Gott um diese Fragen ringen.
Doch nicht nur im Gebet soll unser Glaube aktiv werden im Protest gegen das Unrecht und das Leid dieser Welt. Wir sind gerufen, selbst aktiv zu werden und diese Welt gerechter und barmherziger zu machen. Das Leid ist nicht da, um es zu verstehen, sondern um es zu bekämpfen. Statt uns in theoretischen Erklärungen zu verlieren, sollten wir das Leid sehen und es lindern, wo immer wir können.
c) Die Unverstehbarkeit Gottes
Letztlich können wir Gott nicht vollständig begreifen. Der Prediger sagt:
„Was Gott tut und auf der Welt geschehen lässt, kann der Mensch nicht vollständig begreifen … So sehr er sich auch anstrengt, alles zu erforschen, er wird es nicht ergründen!“ (Prediger 8,16–17)
Gott bleibt grösser als unser Verstand. Die Unbegreiflichkeit des Leidens ist ein Teil des Geheimnisses Gottes. Karl Rahner betont, dass wir Gott als das „unverfügbare Geheimnis“ annehmen und zugleich das Leid in seiner Unerklärlichkeit stehen lassen müssen. Erst wenn wir dies aushalten, werden wir Gott wirklich als Gott begegnen und nicht als blossen Idee, die wir uns zurechtlegen.
Doch wer Leid zu schnell als unbegreiflich abtut, macht es sich zu einfach. So einsichtig dies sein mag. Erst am Ende allen Redens, Fragens und Betens kann diese Erklärung tröstlich und heilsam sein. Kommt sie zu früh, ist sie verfehlt.
Leid stellt Gott in Frage
Am Ende bleibt für mich das Leid – trotz aller Erklärungsversuche – eine Anfrage an Gott. Das Leid stellt Gott, konkret mein Bild von Gott, in Frage.
Für mich selbst ist das Bild von Gott als allmächtiger Superman im Angesicht von Leid, wie dem von Crans-Montana, nicht haltbar. Gott ist kein Wesen, das getrennt von dieser Welt existiert und stoisch über allem steht, stets bereit, mich mit aller Macht aus Gefahr und Bedrohung zu erlösen.
Nein, ich finde Gott in Jesus Christus, dem gekreuzigten und leidenden Messias. Dies ist ein Gott, der sich mit dieser Welt identifiziert, bis hinein ins grösste Leid, in den Tod selbst. Durch die Jahrhunderte hindurch haben Christinnen und Christen im Gebrochenen, Ausgeschlossenen und Leidenden durch Christus Gott gefunden. So möchte ich mich immer wieder aufs Neue durch das Leid herausfordern lassen, um Gott selbst im Leid, Zerbruch und Unbegreiflichen zu begegnen. So möge uns Gott auch im Leid von Crans-Montana beistehen.
[1] https://www.watson.ch/blogs/sektenblog/556360408-crans-montana-troestende-pfarrer-sind-oft-fehl-am-platz
Dieser Text entstand in Zusammenarbeit mit KI-gestützten Werkzeugen. Der Autor hat Inhalte, Struktur und Formulierungen eigenständig konzipiert und redaktionell bearbeitet.