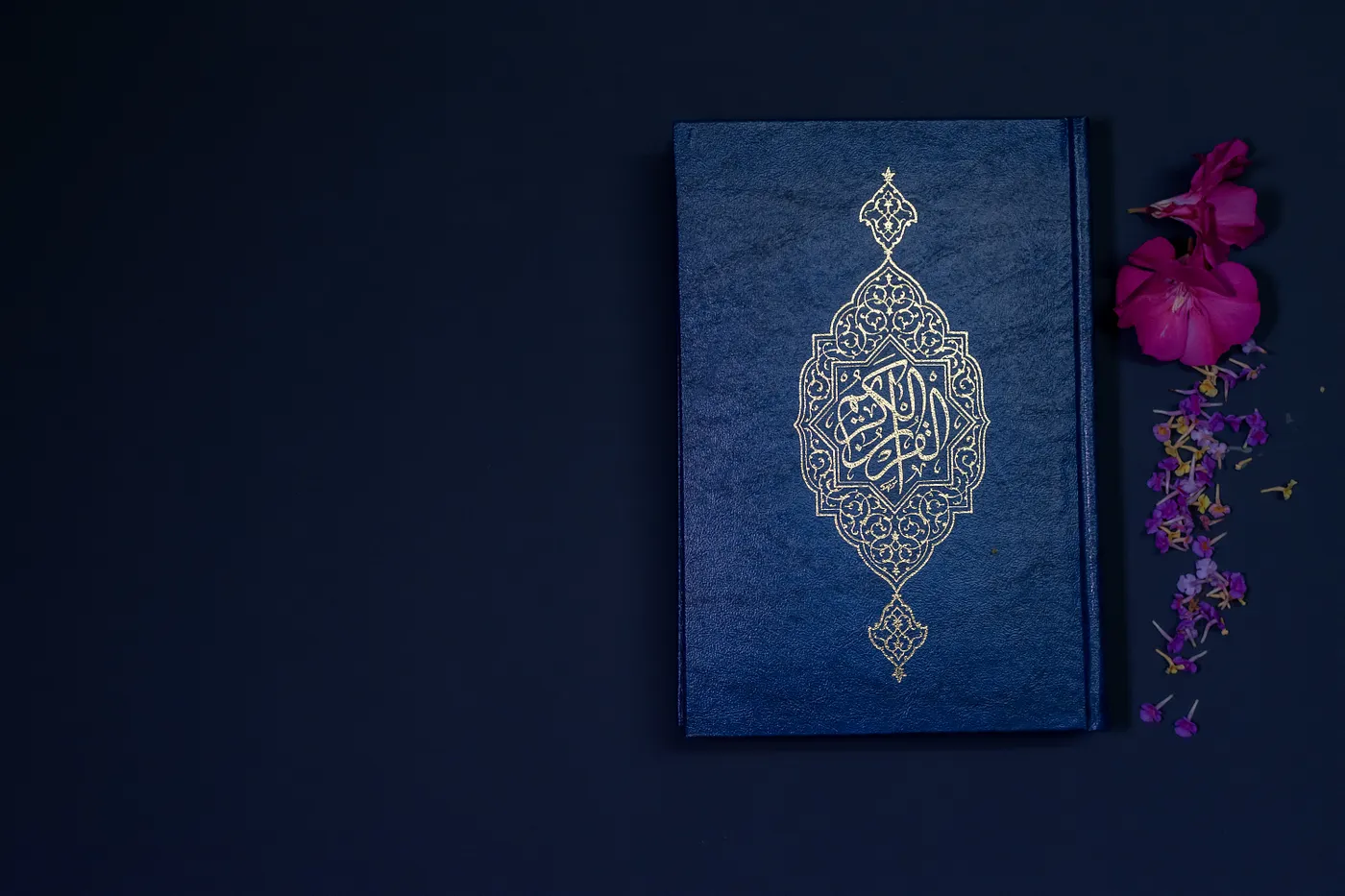Besitzt die islamische Theologie argumentative Ressourcen um Gewalt gegen anders Gläubige zu verurteilen?
Die Welt ist im Wandel. Erst gerade war noch die Flüchtlingskrise in aller Munde, nun beschäftigt uns alle das Corona Virus. Oft ist es das Unbekannte, was uns Angst macht. Dies trifft insbesondere auf den Umgang mit anderen Religionen zu. Gerade der Islam scheint uns im Westen bedrohlich. Ist dem zu Recht so? In diesem Artikel beschäftige ich mich mit dem Gewaltpotenzial des Islams. Konkret soll die Frage beantwortet werden ob die islamische Theologie keine argumentativen Ressourcen besitzt um Gewalt gegen anders Gläubige zu verurteilen.
Die Quellenlage — Koran als gewaltinhärente Schrift?
Immer wieder begegnet mir die These, dass die Gewalt im Koran selbst angelegt sei. So schreibt der Professor für evangelische Theologie an der Universität Lausanne Shafique Kheshavjee, in der Zeitung Le Temps vom 29. Januar 2019: «die Eroberung durch Gewalt ist in den Quellen vorhanden. Diejenigen, die behaupten, den Islam zu missbrauchen, wenn er gewalttätig ist, sind selektive Muslime, die sich nur auf den friedlichen Teil des Korpus verlassen.» Im selben Ton äussert sich Martin Rhonheimer, Professor für Ethik und politische Philosophe an der päpstlichen Universität San Croce in Rom, in der NZZ vom 06. Septemter 2014: «Die islamische Theologie besitzt keine argumentativen Ressourcen, um das Vorgehen des IS als «unislamisch» zu verurteilen.» Solche Einschätzungen des Islams führen zu heftigen Gegenreaktionen, wie dies insbesondere die unzähligen Statements zum Artikel von Rhonheimer zeigen, die wir teilweisse noch aufgreifen werden. Doch benennen Autoren wie Rhonheimer und Kheshavjee nicht schlicht und einfach eine nicht zu überwindende Faktenlage des Islams? Der Textbefund im Koran ist mit Bezug auf Gewalt schwierig. So schreibt Axel Heinrich (2006: 30) über den Djihad, «dass ein vollständiger Ausschluss von Momenten eines gewaltsamen Djihads auf der Basis von Koran und Sunna nicht möglich ist — zu deutlich sind im Koran die Aufrufe zum Kämpfen.» Dabei verweist er insbesondere auf die Suren 2,190–194; 9,5 und 47,4. In diesen Suren finden sich Aussagen wie «Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben; denn die Verführung (zum Unglauben) ist schlimmer als Töten», «tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf!», «Wenn ihr auf diejenigen, die ungläubig sind, (im Kampf) trefft, dann schlagt (ihnen auf) die Nacken». Ist damit nicht belegt, dass der Koran eine gewaltinhärente Schrift ist und der Islam, so lang er am Koran festhält, letztlich nicht vereinbar ist mit der modernen westlichen Gesellschaft? Islamwissenschaftler setzten sich immer wieder gegen solch eine Sicht und Interpretation ein. Mit solchen Argumentationen würde ein zusammenhangsloses “Suren Pingpong” betrieben.
Die Sache mit dem Suren Pingpong
Der Begriff des “Suren Pingpong” stammt von Navid Kermani, deutscher Schriftsteller und habilitierter Orientalist. Er benennt damit den Vorgang, einzelne Verse aus dem Koran aus ihrem textuellen und historischen Kontext zu reissen und ihre Rezeptionsgeschichte nicht zu beachten. Durch solch eine kontextlose Betrachtung werde der Koran zu einem Steinbruch, aus dem sich jeder das nimmt, was gerade zu seiner Darstellung passt. Der Vorwurf, die islamische Theologie hätte keine argumentativen Ressourcen, um Gewalt gegen Ungläubige zu begegnen, sollte gemäss der Argumentation von Kermani widerlegt werden, sobald man den textlichen und historischen sowie den Rezeptionskontext des Korans beachtet. Ob dem so ist, möchte ich in diesem Artikel nach gehen. Dabei sei darauf hingewiesen, dass ich in Fragen des Islam ein Laie bin und der Umfang dieses Essays beschränkt ist. Meine Auseinandersetzung stellt entsprechend eine vereinfachte und selektive Auseinandersetzung mit der überaus komplexen Fragestellung dar. Doch, dass es sich hier um eine verkürzte Auseinandersetzung handelt, ist dahingehend interessant, dass Rhonheimer behauptet, wenn Laien sich mit dem Koran auseinander setzten, diese zwangsläufig zu einer gewalttätigen Interpretation gelangen müssten. Ob dem so ist, wollen wir überprüfen, indem ich als Laie einen verkürzten Blick auf den textlichen und historischen, sowie den Rezeptionskontext des Korans werfe.
Der textliche Kontext einzelner Suren
Eine differenzierte und ausführliche Auseinandersetzungen mit verschiedenen Suren übersteigt den Rahmen dieses Artikels. Ich beschränke mich exemplarisch auf den textlichen Kontext der Sure 9,5. Diese wird immer wieder zitiert, um aufzuzeigen, dass der Islam gewalttätig sei. Der Vers lautet: «Und wenn die verbotenen Monate verflossen sind, dann tötet die Götzendiener, wo ihr sie trefft, und ergreift sie, und belagert sie, und lauert ihnen auf in jedem Hinterhalt. Bereuen sie aber und verrichten das Gebet und zahlen die Zakat (Armensteuer/Almosen), dann gebt ihnen den Weg frei. Wahrlich, Allah ist allverzeihend barmherzig.»
Schauen wir uns nun die Verse rund um diese Stelle an. Der erste Vers in Sure 9 zeigt, dass es um die Frage der Lossprechung von Allah und seines Gesandten von Verpflichtungen gegenüber den Götzendienern geht. Vers 2 spricht davon, dass Allah seinen Plan, die Ungläubigen zu demütigen, unabhängig von der Mitwirkung der Gläubigen durchsetzen wird. Vers 3 wiederholt und verstärkt diese Entschlossenheit Allahs. Vers 4 spricht davon, dass diejenigen Götzendiener ausgenommen sind, mit welchen ein Vertrag besteht und die diesen auch einhielten. Diese «loyalen» Götzendiener sind bis zum Ablauf der Vertragsdauer geschützt. Vers 4 impliziert damit auch, dass Vertragsbrecher nicht zu schützen sind. Vers 5 berichtet nun davon, dass nach dem Ablauf der Frist alle Götzendiener zu töten sind. Vers 6 bringt eine weitere Ausnahme ins Spiel: Unter Schutz stehen die, welche um Schutz bitten. Diesen ist der Schutz zu gewähren, damit sie Allahs Wort vernehmen. Vers 7 spricht wieder von der Ungültigkeit aller Verträge mit Götzendienern. Ausgenommen sind jedoch diejenigen, deren Vertrag von der Moschee bestätigt und von der heidnischen Partei eingehalten wurde.
Der Textzusammenhang zeigt, dass es sich nicht um wahllose Gewalt gegenüber allen Ungläubigen handelt. In Vers 2 wird noch von Ungläubigen gesprochen. Dies wird aber in den weiteren Versen präzisiert auf Götzendiener. Dabei richtet sich der Gewaltaufruf nicht an alle Götzendiener, sondern an die Vertragsbrecher unter ihnen. Problematisch ist jedoch, dass nach Ablauf des Vertrages auch diejenigen der Gewalt ausgesetzt sind, welche zuvor den Vertrag einhielten. Zudem zeigt der Kontext auch, wann von der Gewalt abzulassen ist: nämlich dann, wenn sich ein Götzendiener dem Islam zuwendet. Dieser einfache, verkürzte und laienhafte Einblick in den Textzusammenhang zeigt, dass die Gewalt gewissen Restriktionen unterliegt. Diese sind jedoch äusserst bescheiden und zudem befristet. Der Gewalt zu entfliehen und Anrecht auf Schutz und Asyl zu erhalten, ist nur durch das Eingehen eines Vertrages oder durch die Hinwendung zum Islam möglich. Zudem erscheint mir die Textgattung äusserst problematisch. Diese erinnert mich an das biblische Buch der Sprüche und Prediger. Daher lässt für mich die Textgattung und die damit verbundene Formulierung nur schwer einen Rückschluss auf einen historisch gebundenen Kontext des Textes zu. Vielmehr scheinen für mich die Verse mit dem Anspruch formulieret zu sein, eine zeitlose und damit überkontextuelle Wahrheit zu vermitteln.
Geschichtlicher Kontext
Der geschichtliche Kontext von Korantexten ist insbesondere von der unterschiedlichen Situation in Mekka und Medina geprägt. In Mekka hatte Mohammed keine politische Macht. Er agierte aus einer machtlosen Aussenseitersituation heraus. Suren, die dieser Zeit zugerechnet werden, sind in der Tendenz tolerant formuliert. Dies änderte sich, als Mohammed nach Medina kam. Hier fand er sich in der Situation des Machthabers wieder. Suren, die aus dieser Zeit stammen, sind in der Tendenz gewaltvoller. Die bereits behandelte Stelle aus Sure 9,5 ist ein Beispiel für Verse aus der Zeit in Medina. Hier zeigt sich, wie das Zusammenkommen von religöser und politischer Macht eine schwierige Kombination ist, die ein nicht geringes Gewaltpotenzial aufweist. Dies gilt dabei nicht allein für den Islam. Zu Recht weist der Islamwissenschaftler Tunger-Zanetti in seinem Antwortartikel auf Rhonheimer darauf hin, dass sich die Kirche mit der konstantinischen Wende auf denselben Weg wie Mohammed einliess, politische Macht auszuüben. Doch die konstantinische Wende ist ein ausserbiblisches, kirchengeschichtliches Ereignis und entspricht nicht dem Gründungsimpuls des Christentums. Jesus von Nazareth hat als Begründer der christlichen Religion bewusst auf die Ergreifung von politscher Macht verzichtet. Zu Recht weist Rhonheimer darauf hin, dass die Trennung von Religion und Politik, als auch der Verzicht auf physische Gewalt und die Aufforderung zur Feindesliebe, zu den Gründungsideen des christlichen Glaubens gehören. Dagegen bezeugt der Koran, als Gründungsschrift des Islams, wie Mohammed als Religionsführer auch die politische Macht ergriff und diese unter anderem mit Gewaltakten auslebte. Dieser Blick auf den geschichtlichen Kontext eröffnet für mich zwei Sichten auf die Frage der Gewalt im Koran: Erstens erscheinen die Verse aus der Zeit in Medina problematisch. Der geschichtliche Kontext dieser Verse suggeriert, dass die politische Machtergreifung für Muslime anzustreben ist. Wenn sich Muslime in der Situation des Machthabers befinden, zeigen Texte wie Sure 9,5, dass es durchaus Situationen gibt, in welcher die Gewaltausübung gegenüber Andersgläubigen legitim ist.
Zweitens zeigt der historische Kontext auch auf, dass gerade die Verse aus der Zeit in Mekka eine Ressource für eine Koraninterpretation darstellen, die den Frieden und die Koexistenz mit anders Gläubigen fördert. Damit ist auch aufgezeigt, dass der Koran nicht durchgehend zur Gewalt aufruft. Die Aufforderung zum Kampf im Koran ist an zeitliche, örtliche und situative Bedingungen geknüpft. Aber gerade der geschichtliche Kontext dieser Verknüpfung bringt für mich ein schwieriges Verhältnis von Staat und Politik im Islam mit sich, das es nicht einfach macht, den Kampfaufforderungen einen normativen Wert abzusprechen. Der geschichtliche Kontext und das damit verbundene Verhältnis von Staat und Religion im Islam stellt für mich somit eine grosse Herausforderung in der Frage der Gewalt dar. Zugleich zeigt der geschichtliche Kontext das Friedens- und Toleranzpotenzial verschiedener Koranverse aus der Mekka-Zeit auf.
Auslegungstradition
Sowohl der textliche als auch der geschichtliche Kontext zeigt, dass sich das Gewaltpotenzial der einzelnen Suren durch ihre Kontexte nicht zwingend relativierten lässt. Gleichzeitig wird aber auch aufgezeigt, dass die Gewalt in einen Kontext gestellt ist, Einschränkungen kennt, und der Koran darüber hinaus auch über Ressourcen zur Friedens- und Toleranzförderung verfügt. Was für einen Beitrag leistet der weitere Blick auf die Rezeptionsgeschichte? Auf Grund der vorgegangen Überlegungen mag es überraschen, die islamische Rezeptionsgeschichte ist alles andere als eindeutig und schon gar nicht zwingend Gewalt bejahend. Zu Recht weist Tunger-Zanetti darauf hin, dass es den «wahren» Islam nicht gibt. Zu vielfältig, differenziert und abwechslungsreich ist die Rezeptionsgeschichte im Islam. Entsprechend kann hier auch nur sehr selektiv auf die Rezeptionsgeschichte eingegangen werden. Es gibt unzählige Beispiele, die den Koran gewalttätig auslegen, die ich hier unterschlage. Ich wähle bewusst zwei Beispiele, die aufzeigen, wie gerade die Rezeptionsgeschichte dazu beitragen kann, das Friedens- und Toleranzpotenzial des Korans hervorzuheben. Dies sind erstens Überlegungen zur Abrogation und zweitens die Deutung des Djihads im Sufismus.
Nach Heinrich (2006: 31) ist die Abrogation «die Relativierung bzw. Ausblendung einzelner Passagen des Koran zugunsten anderer, denen sie vermeintlich oder real widersprechen.» So verfolgt die Abrogation das Ziel einer widerspruchsfreien Koran-Auslegung. Den abrogierten Versen kommt nur eine eingeschränkte Bedeutung zu. Diese Art der Auslegung ist in der Frage der Gewalt äusserst problematisch. Sie führt dazu, dass Suren, welche eine durchaus friedliche Konnotation aufweisen, durch gewaltsamere ersetzt werden. So abrogiert zum Beispiel die Sure 9:5 die Sure 8:61, die lautet: «Sind sie jedoch zum Frieden geneigt, so sei auch du ihm geneigt und vertrau auf Allah. Wahrlich, Er ist der Allhörende, der Allwissende.» Gerade von Muslimen, welche sich um eine Reform des Islams bemühen, wird dieses Vorgehen hinterfragt. Mahmud Shaltut (1923–1963) setzt sich z.B. gegen die Abrogation ein. Nach ihm werden zum Teil Verse allein deshalb abrogiert, weil sie dem postulierten Kampfauftrag des Islams wiedersprechen (vgl. Heinrich 2006: 32f). Auch der Gelehrte Abdullahi Ahmed An-Na’im Professeor an der Emory Universety in den USA lehnt in Anschluss an seinen Lehrer M.M. Taha die Abrogation ab und argumentiert, dass die gewaltlegitimierenden Verse nur vorübergehend gültig und nicht rechtlich bindend sind (vgl. An-Na’im 1988: 327ff.). Durch dieses Vorgehen sind die ursprünglicheren Verse aus Mekka für An-Na’im verbindlicher. Hier zeigt sich also, dass gerade die Auslegungstradition Alternativen aufzeigt, welche die These der inhärenten Gewalt im Koran zu hinterfragen vermögen. So ist für An-Na’im die Entscheidung, ob einzelne Suren gewalttätig interpretiert werden, die Folge der menschlichen Auslegung und nicht der inhärenten Bedeutung des Verses selbst (vgl An-Na’im 2006: 792).
Das zweite Beispiel findet sich in der mystischen Tradition des Sufismus. Im Sufismus richtet sich der Kampf nicht gegen Ungläubige sondern gegen das Fleisch und die niedrigeren Instinkte. So wird der Djihad gewaltrestriktiv ausgelegt und als Weg zur geistigen Reinigung verstanden. Dies verdeutlicht die Unterscheidung zwischen dem großen Djihad, welcher der Kampf gegen sich selbst meint, und dem kleinen Djihad, welcher den Kampf gegen die Feinde des Islams beinhaltet. Der grössere Djihad ist der Wichtigere und Schwierigere. Hier eröffnet die Tradition des Sufismus eine allegorischere Deutung der Gewaltverse im Koran, die Ansätze zu einer gewaltlosen Interpretation bietet.
Wie können Reformbemühungen gefördert werden?
Insbesondere der selektive Blick auf die Rezeptionstradtion zeigt, dass der Islam durchaus über argumentative Ressourcen verfügt, um Gewalt gegen Andersgläubige zu verurteilen. Dabei wird jedoch die Frage nach der Akzeptanz solcher Reformbemühungen im Islam virulent. Necla Kelek, Sozialwissenschaftlerin und Publizistin, wirft dem Islam in ihrem bejahenden Antwortartikel auf Rhonheimer vor, dass der Diskurs um Reform seit tausend Jahren verhindert werde. Und auch Heinrich (vgl. 2006 S. 43) hält fest, dass gerade diejenigen, die innerhalb der islamischen Gemeinschaft öffentlich für eine pluralistische und dem Frieden verpflichtete Reform plädieren, Repressionen der traditionalistischen Funktionseliten ausgesetzt sind.
Wer sich darum bemüht, die argumentativen Ressourcen gegen Gewalt an Andersgläubigen in der islamischen Theologie fruchtbar zu machen, steht folglich vor einer schwierigen Aufgabe. Der textliche und historische Kontext ist problematisch, und der Wiederstand in der islamischen Gemeinschaft nicht gering. Doch die Auseinandersetzung mit der Rezeptionsgeschichte zeigt, dass Reformbemühungen existieren. Diese sind zwingend nötig und unbedingt zu fördern.
Zurecht erwidert Ulrich Rudolph, Professor für Islamwissenschaften an der Universität Zürich, auf die Ausführungen Rhonheimers, dass die Diffamierung jeder Form von neuer und subtiler Hermeneutik als «Islam light» hierbei nicht förderlich ist. Wer die Positionen von radikalen islamischen Terroristen als den «eigentlichen» Islam bezeichnet, spielt letztlich diesen Fundamentalisten selbst in die Hände. Zudem ist zu hinterfragen, wie zielführend die Frage nach der Gewaltinhärenz des Korans überhaupt ist. An-Na’im plädiert dafür, dass es viel konstruktiver ist, zu fragen, wie sich der Islam reformieren kann, als sich auf die Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit von Islam und der modernen westlichen Gesellschaft zu fokussieren. Denn der Fokus auf die Gewaltinhärenz und Vereinbarkeit mit der modernen westlichen Gesellschaft versetzt den Islam in eine statisch-essentialistische Position und erschwert so die angestrebte Reformation (vgl. An-Na’im 2006: 791).
Fazit
Diese knappe Auseinandersetzung mit dem Text-, Geschichts- und Rezeptionskontext des Korans zeigt, dass die islamische Theologie durchaus über argumentative Ressourcen verfügt, um die Gewalt an Andersgläubigen zu verurteilen. Wer sich aber darum bemüht, diese Ressourcen fruchtbar zu machen, steht vor einer schwierigen Aufgabe. Einerseits förderte die Erarbeitung dieses Textes meine Dankbarkeit gegenüber der eigenen biblischen Texttradition und andererseits meine Hochachtung gegenüber Muslimen, die sich um eine Reformation des Islams bemühen. An-Na’im ist für mich solch ein Reformer. Sein Hinweis, dass die Fragestellung nach der Gewaltinhärenz im Islam, diesen in eine statische Position versetzt, erscheint mir zentral. Letztlich wird hier ein elementare Grundsatzfrage angesprochen: Traut man dem Islam insbesondere aus westlicher und christlicher Sicht zu, dass er sich wandeln und reformieren kann. Wer dieses Wandlungspotenzial gerade als nicht Muslim verneint, setzt nicht nur den Islam selbst in eine statische Position, sondern steht in der Gefahr sich selbst in einer überlegenen Position zu sehen, die keiner Reform bedarf. Aus meiner Sicht ist jede Religion Stückwerk, eine Aufrichtige Suche nach Gott, die sich ständige reformieren kann und muss. So plädiere ich mit diesem Essay auch klar für das Reformpotenzial des Islams. Dabei ist es wichtig, die islamischen Reformationsbemühungen wertzuschätzen, hervorzuheben und vermehrt bekannt zu machen. Plakative und abschliessende Verurteilungen des Islams als gewaltinhärente Religion sind dabei ebenso wenig hilfreich, wie das Ausserachtlassen der schwierige Situation des textlichen und geschichtlichen Kontextes, wie auch die höchst problematische Unterdrückung und Repression von reformwilligen Muslimen.
Dieser Text wurde eigenständig vom Autor verfasst, ohne Einsatz von KI.
Literaturverzeichnis
AN-NA’IM, Abdullahi Ahmed : Islamic Ambivalence to Political Violence: Islamic Law and International Terrorism, In: German Yearbook of International Law, 31, (1988) 307–336.
AN-NA’IM , Abdullahi Ahmed : Why Should Muslims Abandon Jihad? Human Rights and the Future of International Law In : Third World Quarterly, 27, Nr. 5, (2006), 785–797.
HEINRICH, Axel : Denkmuster zur Eindämmung und zur Legitimation von Gewalt im Christentum und im Islam. Ein Literatureinblick. Bonn 2006.
KELEK, Necla : Eine Religion der Beliebigkeit. Online im Internet : https://www.nzz.ch/feuilleton/eine-religion-der-beliebigkeit-1.18387125 [Stand 30.01.2020].
KERMANI, Navid : Predigt der Koran Gewalt? — Einführung für Laienexegeten In : Süddeutsche Zeitung (2003) vom 4. Februar 2003.
KHESHAVJEE, Shafique Kheshavjee, In: Le Temps (2019) vom 29. Januar 2019, Übersetzung, Prof. Dr. Hansjörg Schmid.
KORAN, DER HEILIGE QUR’AN : Herausgegeben unter der Leitung Hazarat Mirza Tahir Ahmad. Frankfurt 2003.
RHONHEIMER, Martin : Töten im Namen Allahs Online im Internet : https://www.nzz.ch/feuilleton/toeten-im-namen-allahs-1.18378020 [Stand 30.01.2020].
RUDOLPH, Ulrich : Schluss mit den Vorurteilen! Online im Internet : https://www.nzz.ch/feuilleton/schluss-mit-den-vorurteilen-1.18394182 [Stand 30.01.2020].
TUNGER-ZANETTI, Andreas : «Den» Islam gibt es nicht. Online im Internet : https://www.nzz.ch/meinung/debatte/den-islam-gibt-es-nicht-1.18385729 [Stand 30.01.2020].